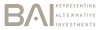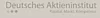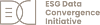Folgen werden zur Belastungsprobe – Lieferengpässe und Finanzierungskosten
Ob es eine wertebasierte Entscheidung war oder doch „nur“ wirtschaftliches Kalkül, muss letztlich offen bleiben, die Zahlen allerdings sind eindeutig: Sofern Unternehmen aus den Portfolien der Private-Equity-Gesellschaften in Russland überhaupt Geschäfte machen, haben die allermeisten PE-Gesellschaften darauf hingewirkt, diese Geschäfte zu verkaufen oder einzustellen. Nur eine sehr kleine Minderheit hat zwar Unternehmen mit Russland-Geschäft im Portfolio, sich aber aktiv dafür entschieden, dieses unverändert weiterzuführen. Das ist das Ergebnis des jüngsten FINANCE Midmarket-Private-Equity-Monitors.
Das Fachmagazin FINANCE lässt zusammen mit der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) die Investment Manager von 50 mittelständischen Private-Equity-Häusern regelmäßig anonym nach ihrer aktuellen Markteinschätzung befragen – zuletzt in der zweiten Maihälfte. Die Leitfrage lautete diesmal, wie der russische Krieg in der Ukraine Private Equity trifft – und wie die Branche mit den Kriegsfolgen umgeht. Beantwortet haben die Fragen dieses Mal weniger PE-Häuser also sonst, möglicherweise, um eine Positionierung in einer heiklen Frage zu vermeiden? Bei den Umfrageergebnissen kristallisieren sich zwei Kernthesen heraus: Die deutsche Private-Equity-Branche bezieht im Ukraine-Krieg Stellung – doch das Geschäft wird, anders als es in der Coronakrise der Fall war, massiv und voraussichtlich auch längerfristig von den Sekundäreffekten des Kriegs belastet.
Russland-Exposure wird zurückgefahren
Wie äußert sich dies im Detail? Die Investment Manager wurden danach gefragt, wie sie mit Russland-Geschäften ihrer Portfoliounternehmen umgehen. Das Ergebnis ist eindeutig: Fast die Hälfte der Fonds (48 Prozent) hat eine Trennung oder das Einstellen von Geschäften in Russland veranlasst – wenngleich das mit Abschreibungen einhergehen kann. Denn nicht mehr erwünschtes Russland-Geschäft wechselt dem Vernehmen nach aktuell eher für einen symbolischen Kaufpreis denn für eine signifikante Summe den Besitzer, zu groß sind wirtschaftliche und Compliance-Risiken. Aber es gibt auch Investoren, die in der aktuellen Lage noch keine Entscheidung getroffen haben: So geben 16 Prozent der befragten Manager an, Portfoliounternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Russland zu haben, aber noch nichts in Richtung Trennung oder Verkauf der Einheiten unternommen zu haben. Eine kleine Minderheit (drei Prozent) der befragten Fonds hat zwar Unternehmen mit Russland-Geschäft im Portfolio, sich aber aktiv dafür entschieden, dieses unverändert weiterzuführen.
Dass Private-Equity-Investoren Russland-Geschäfte trotz allem wie gewohnt weiterführen, könnte unter anderem daran liegen, dass der Anteil russischer Aktivitäten am Gesamtportfolio so gering ist, dass er kaum ins Gewicht fällt – und eine Trennung von den Aktivitäten demnach mit zu großem Aufwand verbunden wäre. Es zeigt aber auch, dass die Geldgeber der Private-Equity-Fonds (noch) keinen großen Wert darauf legen, dass die Umsätze, die die Portfoliounternehmen erzielen, nicht in Russland oder mit russischen Geschäftspartnern realisiert werden.
Für die DBAG ist ein „Weiter so“ keine Option, auch wenn abschließend die Geschäftsführungen der Portfoliounternehmen und gegebenenfalls deren Beiräte entscheiden: „Nach unserer Überzeugung erscheint eine Fortführung des Status quo unvorstellbar. Wir haben unseren Portfoliounternehmen empfohlen, ihr Russland-Geschäft umfassend auf den Prüfstand zu stellen. Diese Entscheidung entspricht nicht zuletzt unserer Selbstverpflichtung, in unserer Geschäftspolitik die Grundsätze nachhaltigen Handelns zu berücksichtigen“, erläutert DBAG-Vorstandssprecher Torsten Grede.

Auch Finanzinvestoren, die kein direktes Russland-Exposure im Portfolio haben, setzen sich mit der Thematik auseinander. So hat knapp ein Fünftel (19 Prozent) der befragten Fonds russische Lieferanten durch solche aus anderen Ländern ersetzt, auch um den Preis, womöglich teurere Einkaufspreise in Kauf nehmen zu müssen. In einer – zumindest mit Blick auf den Ukraine-Krieg – komfortablen Situation befindet sich aktuell knapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent): Sie geben an, dass keines ihrer Portfoliounternehmen Geschäft in Russland hat und sie demnach keine direkten Auswirkungen des Kriegs auf das eigene Portfolio spüren.
Lieferketten nahezu für jeden Investor eine Herausforderung
Während die Frage, wie man mit Geschäft in Russland umgeht, von vielen Finanzinvestoren inzwischen entschieden und damit erledigt ist, drängen mehr und mehr die Sekundäreffekte des Kriegs in den Vordergrund. Dabei müssen die Investment Manager an mehreren Fronten gleichzeitig agieren: Am gravierendsten sind aktuell weitere Lieferengpässe. 87 Prozent der befragten Private-Equity-Manager sehen sich mit Problemen entlang der Lieferkette konfrontiert.
Die Krux: Lieferengpässe sind kein rein kriegsbedingtes Problem, sondern bestehen auch unabhängig davon. Hinzu kommt: Die Lage verschärft sich seit Monaten. Und es ist noch keine Besserung in Sicht. „Die Stabilität der Lieferketten ist bereits seit Beginn der Pandemie eine Herausforderung – insofern gibt es auch schon Erfahrung im Umgang damit. Inzwischen hat sich die Lage allerdings noch einmal verschärft. Der Krieg in der Ukraine und die deshalb nötigen Sanktionen sowie der erneute Lockdown in China verursachen mehr Störungen“, beobachtet DBAG-Vorstandssprecher Grede. Er glaubt, es werde eine Weile dauern, bis die Reaktionen der Unternehmen Wirkung zeigen.

Dementsprechend sind vor allem Finanzinvestoren mit einem signifikanten Anteil an Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe im Portfolio gerade dabei, Lieferketten zu stabilisieren oder zu verlagern, um die Produktion am Laufen zu halten.
Der zweite Faktor, der die Private-Equity-Branche trifft, sind gestiegene Finanzierungskosten. Diese sind für etwas mehr als die Hälfte der Befragten eine Herausforderung (55 Prozent). Marktbeobachter berichten von Steigerungen von zum Teil deutlich mehr als 100 Basispunkten für Standardfinanzierungen – und gehen davon aus, dass die Preise in den kommenden Monaten noch weiter anziehen könnten, sollte die Inflation weiter steigen.
Der Finanzierungsmarkt ist aber keinesfalls verschlossen. Lediglich zehn Prozent der befragten Manager geben an, Schwierigkeiten dabei zu haben, überhaupt Finanzierungen für Transaktionen zu erhalten. Dabei dürfte es sich vor allem um risikoreichere Finanzierungen handeln – oder um Finanzierungen von Deals aus Branchen, die derzeit nicht in der Gunst der Finanzierungsgeber stehen. Das sind zum Beispiel die Automotive-Branche, aber auch Sektoren, die typischerweise viel produzieren und demnach einen hohen Energiekostenanteil haben.


 Newsletter
Newsletter  Kontakt
Kontakt  Downloads
Downloads  Newsletter
Newsletter